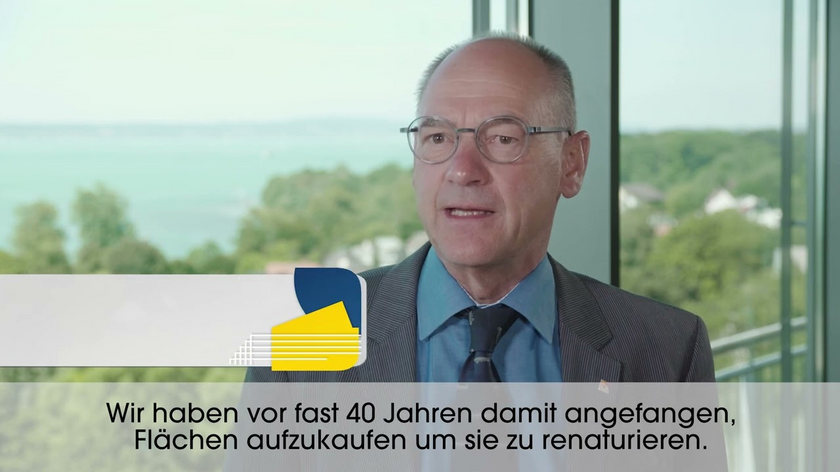Lage und Beschreibung des Projektgebietes
Das ca. 180 ha große Projektgebiet „Niedermoor- und Drumlinlandschaft Hepbacher-Leimbacher Ried“ liegt im Bodenseekreis in den Gemeinden Markdorf, Oberteuringen und Friedrichshafen. Durch die K 7742 wird das Projektgebiet in einen nördlichen und einen südlichen Teil getrennt.
Das Hepbacher-Leimbacher Ried umfasst eines der letzten großen Niedermoore des Bodenseekreises. Der Niedermoorkomplex mit bis zu 10 m Torfmächtigkeiten ist seit Ende der letzten Eiszeit in einem Eisrandtal entstanden, welches durch Schuttkegel in abflusslose Abschnitte unterteilt wurde. In diese vor ca. 15.000 Jahren entstandene Umfließungsrinne des Würmgletschers flossen die Wassermassen aus dem Argen- und Schussengebiet nach Westen ab.
Nutzung
Früher wurden die nassen Flächen zur Einstreu gemäht. Zudem wurde Torf gestochen. In den 60er und 70er Jahren erfolgte eine Intensivierung der landwirtschaftlichen Nutzung, die mit einer Tieferlegung der Brunnisach und einer weiteren Entwässerung einherging. In Folge der Trockenlegung wurde das Gebiet in den nächsten Jahrzehnten intensiv landwirtschaftlich, zumeist als Grünland, aber auch als Acker genutzt.
Ende der 80er bzw. zu Beginn der 90er Jahre wurden in Vertretung der unteren Naturschutzbehörde durch den Bodenseekreis erste Grundstücke auf freiwilliger Basis erworben, um diese naturschutzfachlich aufzuwerten. Es war langfristiges Ziel, große Teile des Rieds zu erwerben, um den Abbau des Moors durch Wiedervernässung der Flächen zu stoppen und als wertvollen Lebensraum für Fauna und Flora zu entwickeln.
Inzwischen stehen nahezu alle Grundstücke des Projektgebietes mit einem Flächenumfang von ca. 210 ha im Eigentum des Bodenseekreises, so dass diese weitgehend ohne Kompromisse naturschutzfachlich entwickelt werden können. Sämtliche Flächen werden inzwischen durch maschinelle Pflege sowie zwei Beweidungsprojekte naturschutzfachlich entwickelt. Ein im Bodenseekreis erstes und für Folgeprojekte wegweisenden Beweidungsprojekt mit Heckrindern im Sinne der Bewirtschaftung als „Wilde Weiden“ wurde in Zusammenarbeit mit dem BUND Markdorf initiiert. Im Projektgebiet wurde über Jahrzehnte freiwilliger Naturschutz ausgeübt.
Auch die Wälder innerhalb des Projektgebietes werden nicht mehr intensiv forstwirtschaftlich genutzt. Altholz wird im Bestand belassen, was einen hohen Anteil an Höhlenbäumen zu Folge hat. Das Gebiet zeichnet sich heute durch eine sehr hohe Strukturvielfalt und demzufolge einer sehr hohen Artenvielfalt aus. Die im Projektgebiet liegenden Drumlins „Mittelberg“, „Balkenrain“ und „Weiherberg“ sind im Flächenumfang von ca. 26 ha überwiegend mit Laubmischwäldern bestockt. Bereichsweise sind Nadelgehölze eingestreut.
Seit fünf Jahren haben streng geschützte Biber im nördlichen Teil des Hepbacher-Leimbacher Riedes eine Heimat gefunden. Aktuell leben dort zwei bis drei Biberfamilien. Durch den Bau von Dämmen in der Brunnisach fließt das Wasser aus dem Gebiet nur noch verzögert ab und verursacht einen Rückstau in der Fläche.
Moore
Im Hepbacher-Leimbacher Ried stehen ca. 100 ha Niedermoor an, welches von Anmoorböden in geringerer Flächenausdehnung arrondiert ist. Der überwiegende Flächenanteil des „Moorkomplexes um das Leimbacher Ried“ befindet sich somit innerhalb des Projektgebietes. Durch die großen zusammenhängenden Flächen im Eigentum des Kreises wird eine flächige Wiedervernässung und Regeneration des Niedermoors erst ermöglicht, denn eine Vernässung auf Einzelparzellen - insbesondere bei den vielen schmalen Flurstücken wie sie im Hepbacher-Leimbacher Ried vorhanden sind - ist nicht umsetzbar. Als Eigentümer von Flächen, die mit Naturschutzmitteln erworben wurden, kann die Bewirtschaftung ausschließlich ausgerichtet an den naturschutzfachlichen Zielen erfolgen.
Eine Abgrenzung der Moorflächen finden Sie hier.
Schutzgebiete
Schutzzweck ist die Erhaltung und Weiterentwicklung von Resten des ehemaligen großen Niedermoorkomplexes Hepbacher und Leimbacher Ried sowie Unterried und Große Ried mit seinen Schilfbereichen, Streuwiesenresten und Hochstaudenrieden sowie verlandenden Weihern als naturnaher Brut-, Rast und Nahrungsraum für viele seltene, zum Teil vom Aussterben bedrohte Tierarten und als Standort einer artenreichen, typischen Niedermoorflora. Das Projektgebiet ist Teil des FFH-Gebietes 8221342 Bodenseehinterland zwischen Salem und Markdorf. Teile des Gebietes sind seit 1983 als 46 ha großes Naturschutzgebiet „Hepbacher - Leimbacher Ried“ ausgewiesen, welches zu Teilen von dem gleichnamigen 67 ha großen Landschaftsschutzgebiet umgeben ist. Diese Flächen sind zugleich als Biotope unterschiedlicher Ausprägung gesetzlich geschützt (Streuwiesen, Sümpfe und Riede, Stillgewässer).
Eine Übersicht über die Schutzgebiete finden Sie hier.
Biologische Vielfalt
Durch die langjährige Pflege, Maßnahmen der Gewässerrenaturierung und Wiedervernässungsmaßnahmen, die inzwischen vom Biber in großer Fläche Unterstützung erfahren, hat sich das Gebiet zu einem Hotspot der Artenvielfalt im Bodenseekreis entwickelt. Von herausragender Bedeutung sind die Niedermoorflächen wegen ihrer faunistischen Vielfalt. Zahlreiche inzwischen selten gewordene und gefährdete Vögel, Amphibien, Schmetterlinge, Heuschrecken, Libellen und Zikaden leben dort. Die hohen Reptilien- und Amphibienzahlen resultieren im Wesentlichen aus der Strukturvielfalt des teils feuchten teils trockenen Geländes. Gleiches gilt für die Artengruppe der Vögel. Auch beherbergen die Streu- und Nasswiesen eine große Fülle an Moosen und Blütenpflanzen, die in der intensiv landwirtschaftlich genutzten Landschaft selten geworden sind und zunehmend seltener werden. Beispielsweise wurde 2021 ein Vorkommen des stark gefährdeten Zungen-Hahnenfuß' (Ranunculus lingua, RL2 Baden-Württemberg) in einem Tümpel der Heckrinderweide festgestellt.
Bei einer Bestandserfassung der Avifauna 2021 (Arbeitsgruppe für Tierökologie und Planung GmbH, Filderstadt) wurden im Bereich nördlich der Kreisstraße mit 51 Vogelarten eine überdurchschnittlich artenreiche Brutvogelgemeinschaft festgestellt. Aus den 289 kartierten Revieren ermittelt sich eine Gesamtsiedlungsdichte von 373 Revieren/100 ha. Insbesondere aufgrund der Wiedervernässungsmaßnahmen weist das Gebiet aktuell bedeutende Vorkommen wertgebender Arten auf, darunter auch zwei vom Aussterben bedrohte Arten wie der Drosselrohrsänger und das Tüpfelsumpfhuhn.
Die ebenfalls 2021 erfolgte Höhlenbaumkontrolle und -neumarkierung der Habitatbäume (Dipl.-Biologin Anne Puchta, Lindau am Bodensee) in den Wäldern des Projektgebietes stellt als Ergebnis eine bereichsweise Höhlendichte von Werten für naturnah bewirtschaftete, 80 bis >180-jährige Buchen- und Buchen-Eichen-Wälder dar. So hat z. B. die Anzahl der Bäume mit Schwarzspechthöhlen gegenüber 2013 um 10 % zugenommen. Die Wälder weisen inzwischen einen hohen Reichtum an Totholz und holzzersetzenden Pilzen und eine Vielfalt an Wuchsformen auf.
Als Ergebnis der Untersuchung von Zikaden und Heuschrecken in den beiden Extensivweiden im Projektgebiet (Dr. Herbert Nickel 2021) wurde festgestellt, dass das Beweidungsprojekt Hutwiesen als richtungsweisend nicht nur für den Insektenschutz, sondern den gesamten Naturschutz im Bodenseegebiet angesehen werden kann. Der in unserer Kulturlandschaft nicht mehr vorhandene selektiver Weidefraß sowie Tritt, Dung und Zoochorie wurden immer wieder als wichtige Faktoren für den Rückgang der Biodiversität identifiziert, zugleich wird ihre Re-Installierung jedoch auch zunehmend als Schlüssel für ihren Erhalt und ihre Wiederherstellung gesehen, der innerhalb weniger Jahre bedeutende Zugewinne auch seltener Arten ermöglicht. Dieser Ansatz wird im Projektgebiet mit den beiden Beweidungsprojekten verfolgt.
Bei einer Amphibien- und Libellenkartierung (Dipl.-Biologe Wilfried Löderbusch 2021) wurden u. a. der seltene Kammolch (Art nach Anhang II der FFH-RL) in den angelegten Kleingewässern nachgewiesen. Der Laubfrosch ist im Gebiet in Tümpeln, Gräben und Überschwemmungsflächen mehr oder weniger allgegenwärtig. Es wurden 17 Libellenarten gefunden, darunter ein großes, vitales Vorkommen der Kleinen Binsenjungfer (Lestes virens vestalis) an und in den Tümpeln auf der Heckrinderweide nördlich der Brunnisach; die Art gilt in Baden-Württemberg als stark gefährdet (RL 2).
Raderacher Weiher
Im Südosten des Projektgebietes liegen die Raderacher Weiher, zwei aufgestaute Gewässer die heute in ausgedehnte Verlandungsbereiche mit Schilf- und Rohrkolbenbeständen übergehen. Daran südlich angrenzende ehemalige Streuwiese versumpfte und entwickelte sich nach und nach zu einem reinen Schilfbestand. Der Südweiher wird nicht genutzt. Natürliche Verlandungsprozesse finden dort statt. Der Nordweiher unterliegt der fischereilichen Freizeitnutzung. Die Raderacher Weiher sind vor allem als Lebensraum für Wasser- und Singvögel sowie verschiedene Amphibienarten von Bedeutung. Seit ein paar Jahren gibt es zudem ein Biberrevier in den Weihern, was bedingt durch Dammbauaktivitäten zu einer Anhebung des Wasserstandes und einer Vernässung der umgebenden Waldflächen führt. Die Raderacher Weiher sind Bestandteil des Naturschutzgebietes.
Entwicklungsziele
Ziele des Projektes „Niedermoor- und Drumlinlandschaft Hepbacher-Leimbacher Ried“ waren und sind:
- Regeneration des Niedermoors, Stopp der Mineralisierung durch Extensivierung und Wiedervernässung von Niedermoor
- Ganzjährig hohe Grundwasserstände im Gebiet
- Förderung und Entwicklung standortspezifischer Vegetation ohne landwirtschaftlichen Nutzungsdruck; Extensivierung der landwirtschaftlichen Nutzung auf Niedermoor
- Förderung und Erhöhung der biologischen Vielfalt durch eine diverse und extensive Flächennutzung, dadurch Förderung der Strukturvielfalt im Gebiet; Beitrag gegen den zunehmenden Verlust der Artenvielfalt
- Naturschutzfachliche Entwicklung des bestehenden Waldes in einen ökologisch hochwertigen Wald-Lebensraum
- Öffentlichkeitsarbeit
- Besucherlenkung
Umgesetzte Maßnahmen
Folgende Maßnahmen wurden und werden seit 35 Jahren im Projektgebiet umgesetzt:
Offenland:
- Umwandlung Acker in Grünland (ca. 3 ha)
- Iniitierung der extensiven Beweidung mit Heckrindern in den Hutwiesen auf ca. 28 ha Fläche (fortlaufende Betreuung, Abstimmung und Finanzierung)
- Initiierung der extensiven Beweidung mit Schottischen Hochlandrindern auf ca. 25 ha Fläche (fortlaufende Betreuung, Abstimmung und Finanzierung)
- Teilrenaturierung der Brunnisaach (ca. 200 lfdm)
- Wiedervernässung von Niedermoorflächen (ca. 100 ha)
- Reduzierung bzw. Aufgabe der Unterhaltung von Entwässerungsgräben
- Anlage von 35 Kleingewässern
- Entwicklung von Sumpfzonen durch Oberbodenabschub
- Entbuschung zur Offenhaltung der wertgebenden Offenlandstrukturen im wiederkehrenden Turnus (5 bis 10 Jahre)
- Heckenpflege im wiederkehrenden Turnus (5 bis 10 Jahre)
- Gestaffelte Mahdtermine der Wiesenflächen (fortlaufende Betreuung, Abstimmung und Finanzierung)
- Freistellen von Kleingewässern von Weidenaufwuchs, Ausbaggern der Kleingewässer im regelmäßigen Turnus (5 bis 10 Jahre)
- Besucherlenkungsmaßnahmen (Wegeführung, Abschrankung)
- Bau einer Beobachtungshütte und Beobachtungsplattform
- Ausarbeitung von Informationstafeln entlang zweier eingerichteter Rundwanderwege
- Spezielle Artenschutzmaßnahmen: Anbringung von Nisthilfen für Störche
Wälder:
- Erhalt von Höhlenbäumen im Kreiswald durch gezielte Markierung und Kontrollen im regelmäßigen Turnus (3 Jahre).
- Naturnahe Bestockung unter Förderung der Naturverjüngung, gezielte Ausbildung von Waldrändern und Niederwald (in kritischen Bereichen in Bezug auf Verkehrssicherungspflicht).
- Spezielle Artenschutzmaßnahmen: Anbringen und Kontrolle von Nistkästen für Hohltauben.
Seit 1989 sind die Raderacher Weiher im Sanierungsprogramm Oberschwäbische Weiher und Seen (SOS) mit dem Ziel, die eutrophen Nährstoffverhältnisse zu verbessern. Im Rahmen des Programms wurden folgende Maßnahmen an den Raderacher Weihern umgesetzt:
- Behebung Abwasser-Falschanschlüsse aus Siedlung und Landwirtschaft im Einzugsgebiet (EZG)
- Vertragliche Flächenextensivierung
- Flächenkauf durch Stadt Friedrichshafen und extensive Bewirtschaftung
- Punktuelle Renaturierungen an Zuflüssen
- Bau eines Schönungsteiches/Sedimentfangs im Zulauf
- Ausarbeitung und Umsetzung eines fischereilichen Bewirtschaftungskonzeptes
- Regelmäßiges Ablassen und Wintern des Nordweihers
Durch die weitere landwirtschaftliche Intensivnutzung im Einzugsbereich vor allem entwässerter Niedermoorböden sowie akkumulierten Nährstofffrachten im Sediment, werden diese Weiher auch künftig in eutrophem Zustand verbleiben.
Seit 2019 hat sich der Biber mit mittlerweile zwei bis drei Familien im Hepbacher-Leimbacher Ried angesiedelt. Durch Dammbauten in der Brunnisach erfolgt der Abfluss der Entwässerungsgräben im Ried stark verzögert. Dies verursacht großflächigen Einstau und Überschwemmungen von Niedermoorflächen. Der Biber hat dadurch seit drei Jahren eine starke Änderung des Wasserregimes in den Niedermoorflächen des Hepbacher-Leimbacher Riedes eingeleitet.
Kooperationen: Zusammenarbeit verschiedener Ressorts und mit anderen Akteuren
Initiator für die Nutzungsextensivierung des Gebietes sowie der Einführung der extensiven Beweidung mit Heckrindern war der BUND Markdorf. Die Herde Heckrinder ist im Eigentum des BUND Ortsgruppe Markdorf.
Die Verantwortung für die Pflege und Entwicklung des Projektgebietes liegt seit 30 Jahren bei der Unteren Naturschutzbehörde. Die Pflege der Flächen innerhalb des Naturschutzgebietes erfolgt in Abstimmung mit dem Regierungspräsidium Tübingen, Referat 56. Die Organisation der Pflege und Entwicklung des gesamten Gebietes, der Grunderwerb und die gesamte Abwicklung des Vertragsnaturschutzes sowie des Monitorings wird seit 30 Jahren von Mitarbeitern der Unteren Naturschutzbehörde durchgeführt. In den umgebenden Wäldern im Eigentum des Landkreises sind über 140 Höhlenbäume markiert. Diese bleiben als Zukunftsbäume im Bestand, sprich werden nicht mit eingeschlagen. Die Auswahl und Markierung der Höhlenbäume wird durch die Untere Naturschutzbehörde beauftragt und durch den Kreisförster bei der Bewirtschaftung entsprechend beachtet. Somit besteht bezüglich dessen eine Kooperation zwischen Unterer Naturschutzbehörde und Unterer Forstbehörde.
Für die Mahd der Offenlandflächen außerhalb der Weide werden örtliche Landwirte beauftragt.
Die Beweidung im Norden des Projektgebietes (Heckrinder) wird in Zusammenarbeit mit einem örtlichen Landwirt abgewickelt. Die Beweidung im Süden (Schottische Hochlandrinder) erfolgt in Zusammenarbeit mit einer Weide GbR aus dem Bodenseekreis.
Die Durchführung erforderlicher Landschaftspflegearbeiten erfolgt mit örtlichen Landschaftspflege- oder Garten- und Landschaftsbauunternehmen.
Die naturnahe Entwicklung der Wälder erfolgt in Zusammenarbeit mit der Unteren Forstbehörde.
Die Stadt Markdorf ist im Besitz weniger Flächenanteile, die überwiegend innerhalb der Heckrinderweide liegen. Weitere wenige Flächenanteile der Stadt Friedrichshafen liegen innerhalb der Weide der Schottischen Hochlandrinder im Süden. Die Organisation der Pflege dieser Flächen wird ebenfalls von der Unteren Naturschutzbehörde geleistet.
Die Umsetzung und Betreuung von Besucherlenkungsmaßnahmen erfolgte als Gemeinschaftsprojekt mit den umliegenden Kommunen: Stadt Friedrichshafen, Stadt Markdorf und Gemeinde Oberteuringen.
Einzelne der genannten Maßnahmen wurden im Rahmen eines internationalen Interegg-Projektes IIIA-Projekt „Feuchtgrünland und Storchenlebensräume durch die Alpenrhein-Bodensee-Anrainer“ 2005 - 2008 umgesetzt. Kooperationspartner hierbei waren Vorarlberg (Österreich), Liechtenstein und die Schweiz.
Öffentlichkeitsarbeit, Umweltbildung, Naturerholung
Zur Naturerholung für die Bevölkerung wurden zwei Rundwanderwege ausgewiesen und beschildert:
- Rundweg Hepbacher-Leimbacher Ried, Länge: 10 km
und
- Naturlehrpfad Hepbacher-Leimbacher Ried, Länge: 4 km
Die Rundwanderwege bieten Ausblicke auf Weiden mit Mutterkuhhaltung, Riedwiesen, Storchennester und Kleingewässer. Es wurden 20 Lehrpfadtafeln ausgearbeitet, die verteilt entlang der Rundwege aufgestellt sind und naturschutzfachliche Informationen zu Sehenswertem in der Umgebung der Tafeln erläutern. Dies sind Informationen zur Geologie (Eiszeiten, Moorentwicklung), Pflanzen und Tiere. Die Tafeln sind im Layout des Bodenseepfades erstellt und somit Teil einer Vielzahl von Besucherinformationstafeln entlang des Bodensees.
Für die beiden Rundwanderwege wurde ein begleitendes Faltblatt ausgearbeitet, welches in den örtlichen Rathäusern, Touristinformationen sowie im Landratsamt erhältlich ist. Im südlichen Teil des Projektgebietes wurde eine Aussichts- und Beobachtungsplattform aus Holz an zwei angelegten Kleingewässern errichtet. Eine Schutzhütte im nördlichen Projektgebiet wurde zur Vogelbeobachtung gebaut. Zudem wurden vier neue Wanderparkplätze rund um das Projektgebiet angelegt.
Zudem nimmt der Bodenseekreis mit den beiden extensiven Weideflächen an dem Projekt „Insektenfördernde Erzeugerregionen“ (EU LIFE Projekt-Insect Responsible Sourcing Regions (IRSR)) teil. Ziel des Projektes ist u. a. die Verbesserung des Schutzes von Insekten und der Biodiversität im Allgemeinen auf der Landschaftsebene. Das Konzept ist auf alle Regionen in Deutschland und der EU übertragbar. Die Beweidungen fungieren im Rahmen des LIFE-Projektes als Muster- oder Vorzeigebetriebe für extensive Weidehaltung („Wilde Weiden“).
Die dargestellten Bausteine für Naturerholung gekoppelt mit Umweltbildung sind im Laufe der Jahre zu einem Gesamtkonzept zusammengewachsen, welches aktives Naturerleben fördert und ermöglicht und zudem durch die Infotafeln und Möglichkeit der Vogelbeobachtung zur Bewusstseinsbildung von natürlichen Zusammenhängen anregt.
Klimaanpassung
Die hohe biologische Vielfalt im Gebiet leistet einen Beitrag zur Stärkung von Populationen. Naturnahe Bedingungen und gesunde, stabile Populationen gewinnen im Zuge des Klimawandels zunehmend an Bedeutung. Sie sind widerstandsfähiger (resilienter) wie auch anpassungsfähiger gegenüber Klimaveränderungen. Auch bei einer hohen Anzahl an verschiedenen Arten und an genetischer Vielfalt gelingt die Anpassung von Arten an den Klimawandel leichter und ein größerer Genpool für Anpassung steht bereit.
„Wertvolle Gebiete als Rückzugsräume werden immer wichtiger, um den Fortbestand heimischer und oftmals gefährdeter Tier- und Pflanzenpopulationen zu gewährleisten“ (Umweltbundesamt 2019).
Mit dem Projekt „Niedermoor- und Drumlinlandschaft Hepbacher-Leimbacher Ried“ wurde ein solcher wertvoller Rückzugsraum entwickelt.
Eine weitere Klimaanpassung ist die erhöhte Retentionswirkung der vernässten Moorflächen. Diese tragen somit wirksam zum Hochwasserschutz und zur verbesserten Grundwasserneubildung bei. Ebenso ist die generell klimaausgleichende Wirkung von Mooren durch hohe Verdunstungsraten zu nennen.
Bodenseekreis Gewinner des Sonderpreises Klimaschutz und Naturschutz im Wettbewerb klimaaktive Kommune 2022
Der Landkreis ist beim Wettbewerb „Klimaaktive Kommune 2022“ des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz ausgezeichnet worden. Der Bodenseekreis erhielt in der Kategorie Klima- und Naturschutz den Sonderpreis für die Renaturierung des Moorgebiets Hepbacher-Leimbacher Ried. Das Preisgeld in Höhe von 25.000 Euro wurde in Grunderwerb im Hebpacher-Leimbacher Ried investiert.
Hier finden Sie zwei Filme zum Projekt: